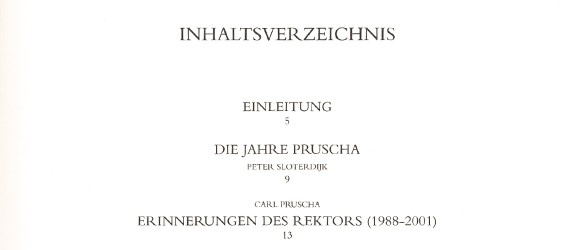official rector portrait – by Eva Schlegel
Die Jahre Pruscha
Zur Physiognomie eines Ausnahmezustands
Seit wann kenne ich Pruscha? Wie der Heilige Augustinus könnte ich antworten, dass ich es weiss, solange mich niemand danach fragt (und das hiesse, dem Gefühl nach: seit jeher), es aber nicht weiss, wenn ich es einem Fragenden erklären soll. Diesem Nichtwissen liesse sich mittels alter Tagebücher und Kalender abhelfen. Ich muss immerhin anderthalb Jahrzehnte im Archiv zurückgehen, bis wir in jeden mittleren und späteren Achtziger Jahren ankommen, von denen uns die heutigen Kulturhistoriker erklären, dass sie unsere Belle Epoque gewesen sind – die Jahre, in denen der Grosse Leichtsinn an der Macht war, eine Zeit, die dem Boom und der Entspannung gehörte, den Grossen Koalitionen und den Grossen Erosionen (die letzteren gaben sich dann nach 1989 im Implodieren der sowjetischen Machtsphäre zu erkennen). Damals kam es soweit, dass es auch in Österreich einigen spätfeudalen Einrichtungen und Zuständen an den Kragen gehen sollte – oder besser, weil wir schon in kragenloser Epoche lebten, an den Schal, der sich genialisch locker um leicht verkühlbare Grosskünstlerhälse wand. Der Wind des Wandels ging durch die Korridore des Ministeriums; respektlos wie eine Naturgewalt wehte er sogar durch die gut isolierten Hallen und Gänge der Akademie der Bildenden Künste zu Wien, wo Geist und Kunst der Nachkriegsära, vor Renovierungen sicher, ein subtiles Asyl gefunden hatte. Die Achtziger Jahre trugen die Perestroika bis in das akademische Refugium der Geniekunst, wo der seit 1918 offiziell entmachtetet Absolutismus mit dem abstrakten Expressionismus und dem Phantastischen Realismus eine zeitenthobene Koalition eingegangen war. Man fand es seitens der Obrigkeit an der Zeit, die letzte Bastion Kakaniens in ein Haus der Gegenwart zu verwandeln; ja man ging so weit, auch den Kunsthabsburgern am Schillerplatz die Demokratie zu bringen. Tatsächlich, die Demokratie und ihre pragmatische Schwester, die Selbstverwaltung, sind hierzulande (ich darf als Halbösterreicher aus Liebe dieses vertrauliche Demonstrativum gelegentlich mitbenutzen) nichts, was das politische Publikum sich aus eigenen Kräften leisten kann. Die Demokratie wurde uns verliehen wie ein Orden; die Selbstverwaltung wurde gewählt wie eine Staatspension. Unter diesem Vorzeichen begannen am Schillerplatz die Jahre Pruscha.
Als ich Carl Pruscha im Jahr 1988 kennen lernte, war er seit wenigen Monaten Rektor des soeben demokratisierten Hauses. Ich wurde damals ein Teil seiner Visionen, in denen die respektvoll so genannte Theorie neben der praktischen Kunstausübung erstmals eine grössere Rolle spielen sollte. Immerhin war die Akademie am Schillerplatz damals der letzte Ort im Westen, wo die Kunst noch ausschliesslich aus den Eingeweiden der Eingeweihten kam. Pruscha überzeugte mich davon, dass die Lage nicht hoffnungslos sei. Sich selbst überzeugte er, dass auch österreichische Genies eine lenkbare Gruppe werden könnten. Ein Genie, eine Stimme – auf dieser Verfahrensbasis sollte auch hier das Abenteuer der Selbstverwaltung zu meistern sein. Pruschas Optimismus war ohne Grenzen. Der Mann den ich damals traf war von einer Aura der Vorherbestimmung zu seinem Amt umgeben, die suggerierte, er habe zeitlebens nichts anderes getan, als die Voraussetzungen für rektorales Wirken zu akkumulieren. Dies mag einer der Fälle sein, in denen der Schein das Wesen nach sich zieht. So habe ich Carl über viele Jahre hin erlebt. Rektor des Hauses am Schillerplatz zu sein, das war wie eine Frucht, die ihm gleich einem Passanten, in den Schoss fiel; es war für ihn ein Zufall der ihn nicht erschöpfte. Zugleich war es ein Ruf aus der Tiefe. Es war ein Anspruch, der an ihn erging, und der ihm sagte: Werde, er du bist. Sei, was du wirst. Carl Pruscha war der Mann der Stunde.
Er war es, weil er der Interpret der geschichtlichen Gelegenheit wurde, die sich unserem Haus – ich darf nach fast anderthalb Jahrzehnten eigener Mitgliedschaft dem pluralis corporationis benutzen- damals bot; er wurde es in dem Mass wie er die Chance der Übergangszeit mit seiner Phantasie, seinem Willen, seiner Beharrlichkeit anzukleiden begann. In dieser Rolle gab es zu ihm ein Jahrzehnt lang keine Alternative. Der Rektor der Akademie am Schillerplatz formulierte auf seine völlig eigentümliche Weise einen Aussage über das demokratische Knistern im Gebälk der österreichischen Zustände. Wenn er mit schöner von Tumulten umwitterter Regelmässigkeit wieder gewählt wurde, so geschah dies, weil er sich selbst in seinem inneren Forum mit wenigen Gegenstimmen gewählt hatte. Er konnte dies tun, weil er in sich überzeugend fand, was das Kollegium damals am meisten brauchte – einen Garanten seiner Freiheit, einen Therapeuten seines Argwohns, einen Beruhiger seiner Ängste und einen listigen Fixegeten seiner alten und neuen Rechte. Pruschas Talent für die Macht bestand darin, dass er ein Naturtalent im Umgang mit Paranoikern war. Er erlaubte jedem, ihn nicht ernst zu nehmen, er bekam fast alles, was er wollte; er vibrierte in seinem eigenen Glück, er setzte durch, was ihm für die Sache richtig schien. Er brauchte das Amt nicht um zu sein, wer er war; er füllte es aus, bis er über die Ufer trat. Er bewies, dass für diesmal der richtige Mann zur richtigen Zeit am richtigen Ort war.
Um Carl Pruschas Leistung zu würdigen, muss man wissen, dass ein Tagungssaal voll österreichischer Grosskünstler strukturell die demokratieunfähigste Gruppe der Welt ist. Eine Versammlung von zerstrittenen Selbstmordattentätern wirkt dagegen harmonisch wie ein Kammerorchester. Wer nicht erlebt hat, wie Pruscha einen Kuriensitzung in Abwesenheit all der hochmögenden Kollegen leitete, wird nie in Erfahrung bringen, wie weit man bei der Einübung demokratischer Formen mit widerstrebendem Personal gehen kann. Wüsste man es nicht anders, könnte man meinen, der Begriff Chaosmanagement sei am Schillerplatz erfunden worden. Auch das Konzept der Emergenz von Ordnung aus Zufall wäre ganz überzeugend als ein Projekt der Pruscha Jahre vorstellbar. Selbst ein bescheidener, scheinbar verbrauchter Ausdruck wie Reform, nimmt im Blick auf diese Zeit eine lebendige Bedeutung an. Dass aus einer bestehenden Form die nachfolgende Form hervorwächst, sofern die Verwandlung von den richtigen Händen betreut wird: Ich denke nachträglich, man darf solche Eindrücke auf unserem intimen Hoffnungskonto verbuchen.
Peter Sloterdijk, 2002